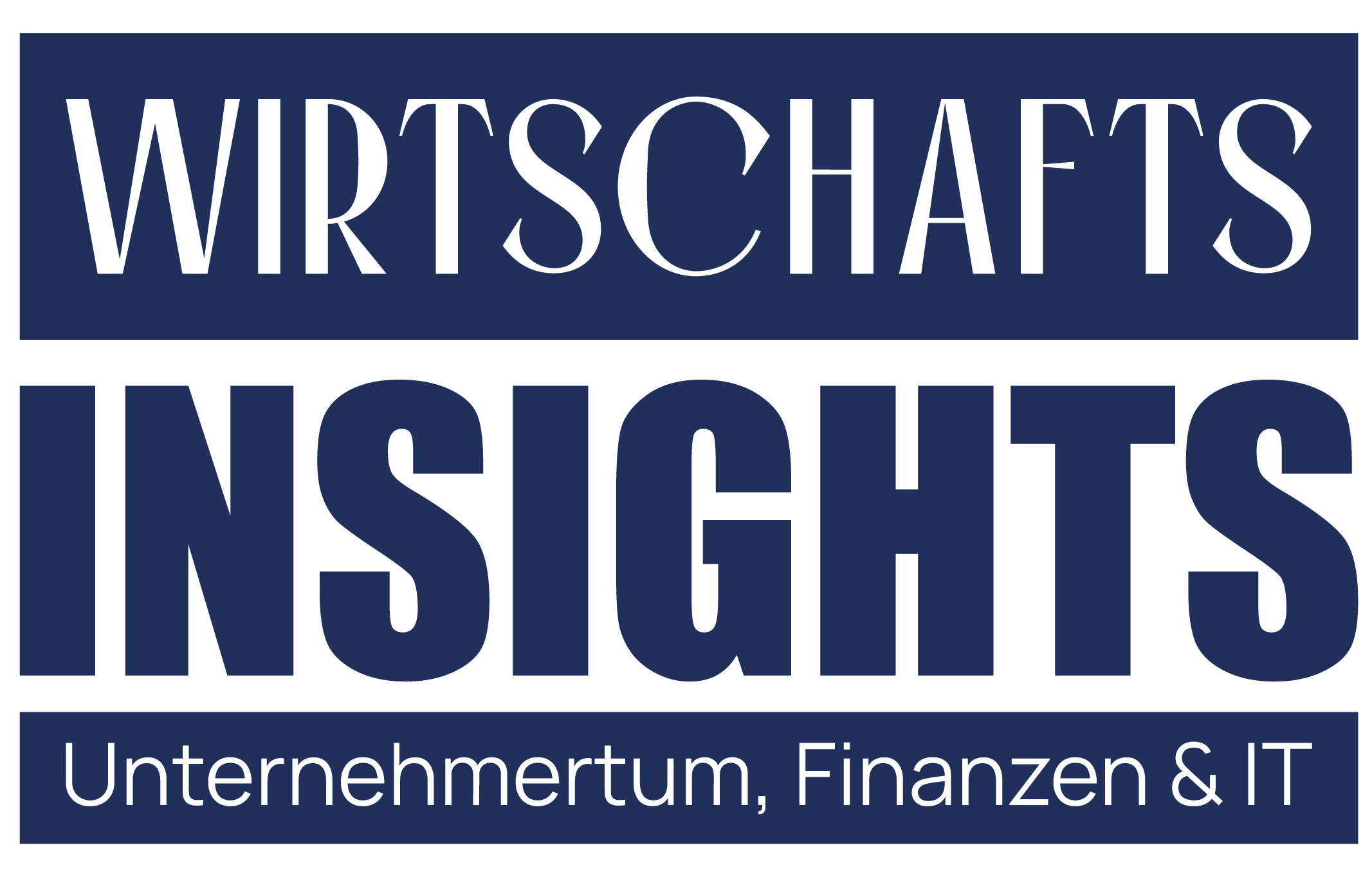Gefährdungsbeurteilung – das Wort allein löst bei vielen Unternehmern Augenrollen aus. Klingt nach Bürokratie, nach Papierkram, nach „muss man halt machen“. Aber ein Metallbauer aus Esslingen berichtete kürzlich von einem Vorfall, der ihm die Augen öffnete: Ein Mitarbeiter rutschte auf verschmiertem Öl aus, fiel gegen eine laufende Schleifmaschine und verletzte sich am Arm. Drei Wochen Arbeitsunfähigkeit, Berufsgenossenschaft war involviert, und die Frage stand im Raum: Hätte das verhindert werden können?
Die ehrliche Antwort: Ja. Eine ordentliche Gefährdungsbeurteilung hätte diese Rutschgefahr erfasst und Maßnahmen definiert – etwa rutschfeste Matten oder regelmäßiges Reinigen. Stattdessen kostete der Unfall Zeit, Geld und fast die Gesundheit eines Mitarbeiters.
Gefährdungsbeurteilungen sind gesetzlich vorgeschrieben, aber nicht nur das: Sie sind sinnvoll. In kleinen und mittleren Unternehmen fehlt oft die Expertise, wie man so etwas praktisch angeht. Deshalb hier eine Anleitung, die auch ohne Beraterhonorar funktioniert.
Schritt eins: Tätigkeiten systematisch erfassen
Bevor irgendwelche Gefährdungen analysiert werden, braucht es einen Überblick: Was wird im Betrieb eigentlich gemacht? Klingt banal, aber viele Unternehmer unterschätzen die Vielfalt der Tätigkeiten.
Ein Tischlereibetrieb mit 12 Mitarbeitern listete auf: Holzzuschnitt an der Kreissäge, Schleifen, Lackieren, Montage beim Kunden, Lagerarbeiten, Bürotätigkeiten. Das sind sechs grobe Bereiche – aber in der Realität kommen noch dutzende Unterpunkte dazu: Transport schwerer Platten, Umgang mit Gefahrstoffen (Lacke, Lösungsmittel), Arbeiten auf Leitern bei Montagen, Fahrzeugführung.
Praktischer Tipp: Eine Woche lang jeden Arbeitsschritt notieren. Nicht theoretisch am Schreibtisch, sondern direkt in der Werkstatt oder im Lager. Was macht Mitarbeiter A am Montag? Was macht Mitarbeiter B? Die Realität weicht oft von der Stellenbeschreibung ab.
Schritt zwei: Gefährdungen konkret ermitteln
Jetzt wird’s praktisch. Für jede Tätigkeit die möglichen Gefahren durchgehen. Bewährte Kategorien:
Mechanische Gefährdungen: Quetschstellen an Maschinen, scharfe Kanten, bewegte Teile. Ein Mitarbeiter an der Abkantpresse kann sich Finger einklemmen – passiert schneller als gedacht, besonders bei Zeitdruck.
Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr: Kabel quer im Gang, Öllachen, unebene Böden. In Lagerhallen mit Gabelstaplerbetrieb oft unterschätzt. Konkrete Frage: Wo liegt im Betrieb etwas rum, worüber man stolpern kann?
Gefahrstoffe: Nicht nur offensichtliche Chemikalien. Auch Holzstaub ist ein Gefahrstoff (krebserregend ab bestimmter Konzentration). Lösungsmittel in Lackierbetrieben, Kühlschmierstoffe in Metallwerkstätten. Für jede Substanz muss ein Sicherheitsdatenblatt vorliegen – nicht im Ordner, sondern griffbereit am Arbeitsplatz.
Physikalische Belastungen: Heben schwerer Lasten (alles über 15 Kilo für Frauen, 25 Kilo für Männer gilt als kritisch), einseitige Körperhaltungen, Vibrationen durch Maschinen.
Psychische Belastungen: Zeitdruck, ständige Störungen, monotone Arbeiten. Wird oft vergessen, gehört aber seit 2013 gesetzlich dazu. Ein Kundendienstmitarbeiter mit 40 Anrufen pro Tag und ständig wechselnden Notfällen – das ist eine messbare psychische Belastung.
Externe Expertise kann hier wertvoll sein, etwa durch Beratung zur Arbeitssicherheit in Baden-Württemberg, wo spezialisierte Fachkräfte KMU bei der Ermittlung unterstützen.
Schritt drei: Risiko bewerten – einfach und nachvollziehbar
Nicht jede Gefährdung ist gleich kritisch. Die Bewertung folgt zwei Faktoren: Wie wahrscheinlich ist ein Unfall? Wie schwer sind die Folgen?
Eine bewährte Skala:
- Wahrscheinlichkeit: 1 (selten) bis 4 (häufig)
- Schwere: 1 (geringe Verletzung) bis 4 (schwere/tödliche Verletzung)
Multipliziert ergibt das einen Risikofaktor von 1 bis 16. Alles über 8 erfordert sofortiges Handeln. Ein Beispiel: Quetschgefahr an einer ungesicherten Presse (Wahrscheinlichkeit 3, Schwere 4 = Faktor 12) – hier muss schnell etwas passieren.
Die strukturierte Vorgehensweise zur Gefährdungsbeurteilung zeigt, dass systematisches Vorgehen nicht kompliziert sein muss, sondern vor allem Konsequenz erfordert.
Schritt vier: Maßnahmen nach dem TOP-Prinzip
TOP steht für Technisch – Organisatorisch – Persönlich. In dieser Reihenfolge werden Schutzmaßnahmen umgesetzt.
Technisch: Die sicherste Lösung. Beispiel Quetschgefahr an der Presse: Lichtschranke einbauen, die bei Griff in den Gefahrenbereich sofort stoppt. Kostet 3.500 Euro, schützt aber zuverlässig. Rutschgefahr: Rutschfeste Bodenbeläge verlegen statt auf Vorsicht zu hoffen.
Organisatorisch: Arbeitsabläufe ändern. Schwere Lasten zu zweit tragen statt allein. Pausen nach zwei Stunden monotoner Arbeit. Wartungsarbeiten nur bei ausgeschalteten Maschinen. Kostet wenig, erfordert aber Disziplin.
Persönlich: Schutzausrüstung als letzte Maßnahme, nicht als erste. Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Handschuhe. Wichtig: Mitarbeiter müssen die Ausrüstung auch tragen – in der Praxis oft das Problem. Ein Schreiner meinte: „Die Handschuhe liegen im Spind, weil sie unpraktisch sind.“ Das zeigt: Persönliche Schutzausrüstung ersetzt keine vernünftige technische Lösung.
Schritt fünf: Dokumentation – was wirklich zählt
Die Gefährdungsbeurteilung muss dokumentiert werden. Aber nicht in 50-seitigen Ordnern, die nie jemand liest. Eine einfache Tabelle reicht: Tätigkeit, Gefährdung, Risikobewertung, Maßnahmen, Verantwortlicher, Termin.
Digital geht’s leichter. Spezialisierte Software gibt’s ab 500 Euro, aber auch Excel-Vorlagen funktionieren. Gerade in Branchen, die ohnehin viel digitalisieren – Themen, die auch in der IT-Wirtschaft relevant sind – bieten sich digitale Lösungen an.
Wichtig: Unterschrift des Unternehmers und Datum. Bei Kontrollen durch die Berufsgenossenschaft oder Gewerbeaufsicht ist das erste, was geprüft wird: Gibt’s eine Gefährdungsbeurteilung und ist sie aktuell?
Schritt sechs: Überprüfung und Anpassung
Eine Gefährdungsbeurteilung ist kein statisches Dokument. Mindestens einmal jährlich überprüfen, besser bei jeder wesentlichen Änderung: neue Maschine, neuer Arbeitsablauf, nach einem Unfall oder Beinahe-Unfall.
Beinahe-Unfälle sind Gold wert. Ein Mitarbeiter stolpert über ein Kabel, fängt sich aber gerade noch – das ist der Moment zu handeln, bevor beim nächsten Mal ein Arm bricht. Viele Unternehmen haben ein Meldesystem für solche Vorfälle. Ein simples Formular reicht: Was ist passiert? Wo? Warum? Was kann man ändern?
Fazit: Weniger Papierkram, mehr Praxis
Gefährdungsbeurteilungen müssen nicht kompliziert sein. Eine ehrliche Bestandsaufnahme, konkrete Maßnahmen und regelmäßige Überprüfung – das reicht. Wer systematisch vorgeht, schützt nicht nur Mitarbeiter, sondern spart langfristig auch Geld durch weniger Ausfälle und Unfälle. Und sollte doch mal die Berufsgenossenschaft vorbeischauen, gibt’s keine bösen Überraschungen.
Bild von Pawel Szymczuk auf Pixabay